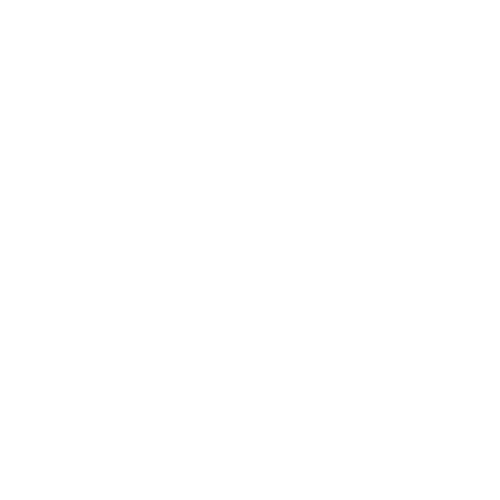←

Erklärung für:
Matthäusevangelium
3
:
1
In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht:
11
more explanations
& daily audio-books
Hilf uns das
Deutsch-Orthodoxe
Kloster zu bauen.
Das Dreieinigkeits Kloster in Buchhagen braucht deine Unterstützung, um die Kirche fertigzustellen.
Spenden gesammelt:
spoken by
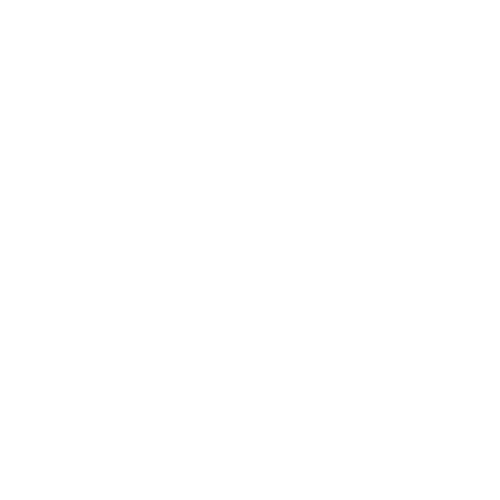

– enjoy in Theosis App –
Start your
Bible-journey
with explanations
& daily audio-books
only 4$* per month
{"arr":[{"author-name":"Johannes Chrysostomus","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c88ea76859f9f8e2ffd3ee_John%20Chrysostom.png","category":"Heilige Väter und Lehrer","century":4,"exegesis-text":"An welchen Tagen geschahen diese Ereignisse? Laut dem heiligen Lukas trat Johannes nicht während der Kindheit Jesu auf, als dieser nach Nazareth zurückkehrte, sondern erst nach drei Jahrzehnten. Was bedeutet der Ausdruck „in den heutigen Tagen“? Diese Formulierung findet sich häufig in der Heiligen Schrift und bezieht sich nicht nur auf unmittelbar aufeinander folgende Ereignisse, sondern auch auf solche, die viele Jahre zurückliegen. Als die Jünger sich zu Jesus begaben, der auf dem Ölberg saß, und ihn sowohl über sein Kommen als auch über die Zerstörung Jerusalems fragten (und ihr wisst, wie viel Zeit zwischen diesen beiden Geschehnissen verstreichen wird), fügte er hinzu, nachdem er von der Zerstörung der jüdischen Hauptstadt gesprochen hatte und über das Ende der Welt sprach: „Dann wird auch dies geschehen.“ Mit dem Wort „dann“ verwies er nicht auf eine Verwechslung der Zeiten, sondern auf den bestimmten Zeitpunkt, an dem das Ende der Welt eintreten würde. Ähnlich werden hier die Worte „in diesen Tagen“ verwendet. Der Evangelist bezieht sich nicht auf die unmittelbar bevorstehenden Tage, sondern auf jene, in denen die Ereignisse stattfänden, über die er sprechen möchte. Doch warum fragt ihr, kam Jesus erst nach dreißig Jahren zur Taufe? Weil er mit dieser Taufe das Gesetz erfüllen wollte. Er wollte nicht, dass jemand behauptet, er habe das Gesetz nicht erfüllen können, sondern hat es während des Zeitraums, der in der Regel für alle Sünden gilt, in vollem Umfang eingehalten. Nicht immer wirken alle Unarten in uns: In den frühen Jahren sind oft Unverstand und Furcht vorherrschend, während in späteren Zeiten das Verlangen stärker wird, und in der nächsten Zeit das Streben nach materiellem Besitz. Darum kommt Christus, nachdem er all diese Lebensabschnitte durchlaufen und das Gesetz vollkommen erfüllt hat, zur Taufe, mit der er den Abschluss aller Gebote vollzieht. Da die Taufe das letzte Werk des Gesetzes war, hört man seine Worte: „So ziemt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen“ (Mt 3,15). Die Bedeutung dieser Worte ist: Wir haben alles erfüllt, was das Gesetz verlangt; wir haben kein Gebot übertreten. Da nun nur noch die Taufe aussteht, müssen wir auch diese vollziehen, um die gesamte Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit „Gerechtigkeit“ ist hier die Erfüllung aller Gebote gemeint. So wird klar, warum Christus zur Taufe ging. Aber warum taufte Johannes? Laut Lukas tat Johannes dies nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Gottes Befehl: „Das Wort des Herrn kam zu ihm“ (Lk 3,2). Johannes selbst erklärt: „Der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt: Über ihm wirst du den Geist wie eine Taube herabkommen und auf ihm bleiben sehen; er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft“ (Joh 1,33). Zu welchem Zweck wurde er gesandt? Auch hier gibt der Täufer selbst Auskunft: „Ich habe ihn nicht gesehen, sondern dass er Israel erscheine; darum bin ich gekommen, um mit Wasser zu taufen“ (Joh 1,31). Doch was erklärt dann der Evangelist Lukas? Er berichtet, dass Johannes in das Land des Jordans kam und die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden predigte (Lk 3,3). Die Taufe des Johannes gewährte keine Vergebung der Sünden. Letztere ist das Geschenk der Taufe, die uns zuteilwurde, als wir mit Christus begraben und unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wurde; vor dem Kreuz Christi gibt es keine Vergebung der Sünden: Diese wird immer mit seinem Blut verbunden. Der Apostel Paulus sagt: „Wir aber sind gewaschen, aber geheiligt, nicht durch die Taufe des Johannes, sondern durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes“ (1 Kor 6,11). An anderer Stelle sagt er: „Denn Johannes hat die Taufe der Buße gepredigt – es wird nicht von Vergebung gesprochen –, damit sie an den glauben, der nach ihm kommt“ (Apostelgeschichte 19,4). Und wie könnte es Vergebung der Sünden geben, wenn kein Opfer dargebracht, kein heiliger Geist herabgebracht, keine Sünden ausgelöscht, keine Feindschaft getilgt und kein Fluch aufgehoben wurde? Was bedeutet es also, von Vergebung der Sünden zu sprechen? Die Juden waren unbußfertig und erkannten nie ihre Sünden und hielten sich stets für gerecht, da sie extremer Sünde unterworfen waren, was sie besonders verderbte und vom Glauben abbrachte. Der Apostel Paulus wirft ihnen vor: „Sie verstehen die Gerechtigkeit Gottes nicht und suchen ihre eigene Gerechtigkeit zu errichten; sie gehorchen der Gerechtigkeit Gottes nicht“ (Röm 10,3). Und erneut fragt er: „Was sagen wir? Israel aber, das das Gesetz der Gerechtigkeit suchte, gehorchte dem Gesetz der Gerechtigkeit nicht. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken kommt“ (Röm 9,30-32). Da dies die Ursache ihrer Verfehlungen war, kam Johannes, um sie zur Einsicht über ihre Sünden zu führen. Sein Auftritt drückte dies bereits aus und veranlasste sie zur Buße und zum Sündenbekenntnis; auch seine Lehre vermittelte dies, als er nur sagte: „Bringt Früchte hervor, die der Buße würdig sind“ (Lk 3,8). Somit, wie auch der Apostel Paulus sagt, hielt ihr mangelNDES Bewusstsein für ihre Sünden sie von Christus fern, während die Erinnerung an ihre Sünden sie zur Suche nach dem Erlöser und der Vergebung anregte. Der Zweck von Johannes’ Kommen war es also, sie auf ihre Sünden aufmerksam zu machen und sie zur Buße zu bewegen; nicht, um sie zu bestrafen, sondern damit sie durch die Buße demütiger würden, sich selbst anklagten und nach Vergebung suchten. Der Evangelist hebt dies treffend hervor. Nachdem er erzählt hatte, dass Johannes in der Wüste von Judäa kam und die Taufe der Buße predigte, fügt er hinzu, zur Vergebung, als wolle er sagen: Er überredete sie, ihre Sünden zu bekennen und zu bereuen, nicht um sie zu strafen, sondern um ihnen zu helfen, die folgende Vergebung besser zu empfangen. Hätten sie sich nicht selber verurteilt, hätten sie nicht um Barmherzigkeit gebeten, und hätten sie nicht gesucht, hätten sie keine Absolution erhalten."},{"author-name":"Theophylakt von Bulgarien","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c8989296bafed9104677d7_Theophylact%20of%20Bulgaria.png","category":"Heilige Väter und Lehrer","century":11,"exegesis-text":"In der Zeit, bevor der Herr als Kind in Nazareth lebte, berichtet der Evangelist allgemein von der Periode, in der Johannes der Täufer erschien. Johannes wurde von Gott gesandt, um das Volk Israel zu ermahnen, ihnen ihre Sünden vor Augen zu führen und sie dadurch auf die Annahme Christi vorzubereiten. Denn nur wer sich seiner Sünden bewusst ist, kann zur Umkehr gelangen."},{"author-name":"Euthymios Zigabenos","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c96d263b8c22d9c467bdab_no-pic-theosis.png","category":"Christliche Autoren","century":11,"exegesis-text":"In welcher Zeitspanne geschah dies? Es war nicht während der Kindheit Jesu, als er aus Ägypten nach Nazareth zurückkehrte, sondern erst nachdem er das Alter von dreißig Jahren erreicht hatte, wie es im Evangelium nach Lukas berichtet wird (Lk 3,23). In den Heiligen Schriften wird der Ausdruck \\"in den Tagen dieser Tage\\" oft ohne spezifische Zeitangabe verwendet; stattdessen wird lediglich die Zeit betrachtet, in der das Geschehene stattfand. So hat es auch der Evangelist gehalten, indem er die Informationen über die vorhergehenden Jahre ausgelassen hat. Warum ließ sich Christus taufen, nachdem er dreißig Jahre alt geworden war? Weil dies das Alter der reifen und vollkommenen Weisheit darstellt. Er hatte die Absicht, den alten Bund aufzulösen und einen neuen zu etablieren, wofür eine solche Weisheit unerlässlich war. Nachdem er die Phasen der Kindheit mit ihrer Unmündigkeit, der Jugend mit ihren Leidenschaftskämpfen und der jungen Erwachsenenzeit durchlaufen hatte, trat er im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Reife zur Taufe, sodass er, nachdem er durch diese geoffenbart worden war, sofort mit dem Lehren und Wundertätigen beginnen konnte. Aus diesem Grund sandte Gott Johannes an den Jordan, um die Botschaft der Taufe zu verkünden, damit sich viele zur Taufe versammeln würden. Christus, der inmitten dieser Menge stand, erhielt sowohl das Zeugnis von Johannes als auch das des Vaters und des Heiligen Geistes, und nachdem er diese Gaben empfangen hatte, begann er die Menschen in den Sakramenten zu unterweisen und Zeichen zu wirken. Woher kam Johannes? Er stammte aus der inneren Wüste; denn Lukas berichtet: \\"Das Wort Gottes kam zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er ging in das gesamte Gebiet am Jordan\\" (Lk 3,2-3). Matthäus bezeichnete dieses Gebiet am Jordan als die Wüste der Juden. Es gab somit zwei Wüsten: eine im Landesinneren, aus der er gekommen war, und eine andere in der Nähe des Jordans, wohin er ging."},{"author-name":"Lopuchin A.P.","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c891400ee1341634d2276d_Lopuchin%20A.P..png","category":"Christliche Autoren","century":19,"exegesis-text":"Als die göttliche Offenbarung des Heilands im entfernten Nazareth sich dem Ende näherte, war in der Einsamkeit nahe Jerusalems bereits jener „Engel“ herangewachsen, der, gemäß der Vorhersage des Propheten Maleachi, den Weg bereiten sollte. Der Sohn des frommen Zacharias und der Elisabeth, Johannes, der unter dem segensreichen Einfluss seiner gläubigen Eltern aufwuchs, entwickelte von Kindesbeinen an eine Vorliebe für Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Mit zunehmendem Alter suchte er die umliegenden Wüsten als seinen Rückzugsort auf. Dieser Geist der Enthaltsamkeit wurde durch die widrige Lage des jüdischen Volkes in jener Zeit noch verstärkt. Es war tatsächlich eine herausfordernde Epoche für das auserwählte Volk. Das machtbesessene Rom, das eine Zeit lang die Scheinunabhängigkeit Judäas unter der Herrschaft seiner Könige hingenommen hatte, legte nun endgültig seine eiserne Hand der Tyrannei darüber und stellte Judäa, nach der Absetzung von Herodes' Sohn Archelaus, unter die Herrschaft eines römischen Statthalters, dem sogenannten Prokurator, der wiederum einem hochrangigen Beamten, dem Präfekten von Syrien, unterstand. Mit dem Beginn der römischen Herrschaft wurden zudem römische Sitten und Gebräuche etabliert, die von den Juden als heidnisch und als unerträglich empfunden wurden, da sie eine eklatante Verletzung all ihrer wertgeschätzten Traditionen darstellten. Ein starkes römisches Kommando nahm schließlich den Turm von Antonia in Besitz, der an den Tempel grenzte, und der furchterregende Anblick dieser Heiden trübte den Seelenfrieden aller Tempelbesucher. Die in den Städten stationierten römischen Soldaten belasteten das Volk mit Steuern und Erpressungen; die Steuerlast stieg, und das von den Römern eingeführte System der Steuereintreibung durch Zöllner führte dazu, dass sich eine Klasse von schamlosen Räubern formierte, die von der Not des Volkes profitierte, was zu Irritationen und Widerstand führte. An einigen Orten formierten sich Gruppen von Aufständischen, die sich weigerten, Steuern an Cäsar zu zahlen, und diese Weigerung zur heiligen Pflicht für jeden wahrhaft gläubigen Israeliten erklärten, sodass ihr Widerstand gegen die Römer noch mehr Unruhe und Verwirrung unter der friedlichen Bevölkerung des Landes brachte. Inmitten dieser bedrängenden Lage suchte das Volk daher oft Zuflucht in die Wüste, um dort, den Seufzer der Freiheit atmend, seine erschöpften Seelen in einem vertraulichen Gespräch mit Gott und einem innigen Flehen nach dem baldigen Kommen des Erlösers zu erquicken. Inmitten dieser allgemeinen Sehnsucht erklang in einer der rauesten Wüsten die Stimme eines großen neuen Propheten, und die Kunde von ihm verbreitete sich schnell im ganzen Land. Dies geschah im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des römischen Kaisers Tiberius, während der Amtszeit des Prokurators Pontius Pilatus in Judäa. Seit der Zeit Maleachis war die prophetische Stimme unter dem auserwählten Volk vollständig verstummt, und das Volk war über ein ganzes Jahrhundert hinweg gezwungen gewesen, seine religiöse und moralische Kraft allein aus dem Gesetz und der Tradition zu schöpfen. Man hatte sich so sehr an diesen Zustand gewöhnt, dass man nicht mehr mit dem Erscheinen neuer Propheten rechnete, sondern lediglich auf das Erscheinen Elias als direkten Vorläufer des Messias hoffte. Und dieser Elia trat gewissermaßen in der Person von Johannes auf. Als strenger Nazarener erschien Johannes in der Wüste nicht nur im Geist und in der Kraft des Elias, sondern glich ihm auch in seinem gesamten Erscheinungsbild und seiner Lebensweise. Wie sein großes Vorbild trug er ein grobes Gewand aus Kamelhaar, das mit einem Ledergürtel gehalten wurde, und ernährte sich von den spärlichen Gaben der Wüste – wildem Honig, den man manchmal in unzugänglichen Felsspalten fand, und Acriden, also sonnengetrockneten Heuschrecken (die von den Beduinen auch in Hungersnöten verzehrt werden). Das Auftreten eines solchen Propheten musste die Aufmerksamkeit aller erregen, zumal seine Botschaft die entscheidende Frage behandelte – den Zeitpunkt der Ankunft des Messias."},{"author-name":"Paul Matwejewski","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c8969f5be0d592d5a10576_Paul%20Matwejewski.png","category":"Christliche Autoren","century":19,"exegesis-text":"Schon lange vor der Ankunft des Heilandes auf Erden wurde den Propheten des Alten Testaments offenbart, dass Jesus Christus einen Vorläufer erhalten würde, um die Menschen auf seinen Empfang vorzubereiten. Der Prophet Maleachi, der von dem Vorläufer des Herrn spricht, bezeichnet ihn als den Engel Gottes und als den zweiten Elia (Maleachi 3,1; 4,5). Der Prophet Jesaja vernimmt in heiliger Freude die Stimme dieses Rufers in der Wüste: „Bereitet dem Herrn den Weg, macht die Pfade unseres Gottes gerade. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden; die Krumme soll gerade, und das Unebene soll glatt werden, und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbart werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen, wie der Herr geredet hat“ (Jesaja 40,3-5). Durch prophetische Einsicht blickt Jesaja auf die Rückkehr des jüdischen Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft, geleitet von Gott selbst. Er beschreibt den Boten, der in einsamen, unwegsamen Gegenden die Vorbereitung für die Ankunft des Herrn verkündet, um sein Volk zu leiten. Der prophetische Geist offenbart dem Propheten nicht nur das nahe Ereignis, sondern auch die zukünftige Heilsordnung, die am Ende der Tage sichtbar werden sollte. Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas sehen in seinen Worten einen direkten Hinweis auf einen anderen Boten, der das kommend Heil und die Befreiung der Menschen aus der Sklaverei der Sünde und des Teufels ankündigt (Joh 8,34.36.44). Dieser „Vorläufer in der Geburt und im Wort“, der „Leuchtstern, der dem Licht zuvor scheint“, war Johannes, der Sohn des gerechten Zacharias und der Elisabeth, dessen Ankunft von wundersamen Zeichen und Vorhersagen über sein großes Schicksal geprägt war. Er schloss die Reihe der alten Propheten und des mosaischen Gesetzes ab, indem er das Kommen des gnadenreichen Reiches Christi verkündete (Matthäus 11,13). Während die alttestamentlichen Propheten Christus in schrittweise klarer werdenden Visionen sahen und sein Kommen in weiter Zukunft erwarteten, sah Johannes ihn klar und wies alle, die auf die Ankunft des Messias warteten, auf ihn hin (Johannes 1,29, 30). Daher war er nicht weniger Prophet als die vorherigen, und er war größer als die, die von ihm geboren wurden (Matthäus 11,9, 11). In den Worten der Kirchenlieder wird er als „heller Morgenstern“ beschrieben, der den Glanz aller anderen Sterne überstrahlt und die bevorstehende Dämmerung des gnadenreichen Tages ankündigt, der von der göttlichen Sonne - Christus - erleuchtet wird (Maleachi 4,2). \\n\\nWährend Jesus bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr in der bescheidenen Umgebung eines Zimmermanns in der Stille des wenig bekannten Nazareth lebte, bereitete sich sein Vorläufer in der Einsamkeit der Wüste auf seinen bedeutsamen Dienst vor. In der Wüste, vor dem Antlitz Gottes, fern von den Eitelkeiten der Menschen, bewahrte er seinen Geist rein und his Herz frei von weltlichen Begierden und falschen Hoffnungen. Nichts hinderte ihn daran, seine geistliche Trauer im Gebet auszudrücken, und er war ungehindert in seiner tiefen Selbstreflexion. In den einsamen Gesprächen mit sich selbst und mit Gott, im Nachdenken über die Vergangenheit und die Zukunft seines Volkes, ließ sich Johannes von der majestätischen Natur und dem Glauben an Gottes Führung moralisch stärken. Es ist unbestreitbar, dass Gott, der ihn zu einem großen Werk berufen hatte, ihn sowohl direkt als auch durch seine Engel auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitete. Sein Leben war durch außerordentliche Strenge geprägt, wie es sich für einen großen Asketen gebührt. Bereits vor seiner Geburt kündigte der Engel seinem Vater Zacharias an, dass Johannes keinen Wein oder starke Getränke zu sich nehmen würde (Lukas 1,15), was auf sein Gelübde des Nasiräertums hinweist, das Enthaltsamkeit von berauschenden Getränken verlangt. Die Wüste, in der Johannes lebte, war zwar nicht völlig unbewohnt, aber bekannt war sie für ihre Strenge und Wildheit: ein gebirgiges, bewaldetes Gebiet mit Felsen und Schluchten. In dieser Einsamkeit lebte Johannes in Abgeschiedenheit und besaß nur das Nötigste, das ihm die Wüste bot - Heuschrecken und wilden Honig. Der Mönch Isidore von Pelusium bemerkt, dass die „Heuschrecken“, von denen Johannes sich nährte, nicht die heutigen Insekten waren, sondern die Spitzen von Kräutern, und dass auch der wilde Honig ein sehr bitterer Berghonig war. Johannes machte dadurch deutlich, wie sehr er unter Entbehrungen und Strenge litt. Seine Enthaltsamkeit war so strik gesagt, dass man sagen kann: „Er aß und trank nicht“ (Matthäus 11,18). Der heilige Johannes Chrysostomus stellt fest, dass er das Fleisch trug und einen Lebensstil führte, der dem eines Engels glich.\\n\\nDer moralische Zustand des jüdischen Volkes, während Johannes das Kommen des Erlösers verkündete, war desolat. Seine Wüste war umgeben von einer geistlichen Dürre, in der der Prophet von einer Hungersnot sprach - nicht nach Brot oder Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn (Amos 8,11). Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die auf dem Stuhl des Mose saßen (Matthäus 23,2) und den Schlüssel des Verstandes hatten, traten selbst nicht in die Erkenntnis der Wahrheit ein und hielten andere davon ab, hineinzutreten (Lukas 11,52); sie waren blinde Führer der Blinden (Matthäus 23,16; Lukas 6,39). Das Volk, beraubt seiner geistlichen Leitung, war in Lastern und irdischen Sorgen gefangen, wobei es sogar von dem Messias irdische Vorteile erwartete. Es bedurfte der deutlichen Stimme des Vorläufers, um die Sündigen, die im geistlichen Schlaf lagen, aufzuwecken und ihre Augen auf das kommende Reich der Gnade zu lenken. Ein strenges und enthaltsames Leben war notwendig, um der Zurechtweisung Glaubwürdigkeit zu verleihen. Um das Evangelium vorzubereiten, musste der Vorläufer die Schwächen der Menschen stärken und ihnen die Nähe des Heils vor Augen führen; er musste Hochmut und Überheblichkeit anprangern und Tugend lehren, während er sich vom Laster abwandte. Um dieses heilsfördernde Ziel zu erreichen, erforderte es hohe geistliche Ansprüche. Doch Gottes besondere Stimme berief Johannes zu diesem Werk und öffnete ihm den Zugang zu einem so wichtigen Auftrag, in dem ihm die Hoffnung auf göttliche Hilfe und das Gefühl der ihm verliehenen Kraft zuteilwurde. Kurz bevor der Herr Jesus Christus sein öffentliches Wirken begann, trat Johannes als Vorläufer mit seinen vorbereitenden Predigten auf. Schon bald wurde er zu einer leuchtenden Lampe (Johannes 5,35), deren Licht über das umliegende Land strahlte. Getrieben von unermüdlichem Eifer für Gott, verkündete er seinen Landsleuten das Wort der Wahrheit und lebte ein Leben der Askese. Es verbreitete sich das Gerücht, dass in der jüdischen Wüste ein Mann lebte, der dem großen Propheten Jesaja in seiner Lehre und dem Elia in seinem Lebensstil glich. Dieser außergewöhnliche Mann begann seine Botschaft auf eindringliche Weise: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe.“ Für seine Zeitgenossen, die auf die Ankunft des Messias warteten, war klar, dass mit diesem Reich die Zeit des Messias gemeint war. Doch nur wenige waren sich dessen bewusst, dass man, um würdig in dieses Reich einzutreten, sich von weltlichen Erwartungen trennen, alle schlechten Gewohnheiten ablegen und die Seele durch aufrichtige Reue läutern musste. Nur die frommsten Juden hatten keine irdischen Erwartungen an das Reich des Messias, weshalb die Bußpredigt von Johannes notwendig wurde, um das Volk auf die Ankunft des Erlösers vorzubereiten. Später begann auch der Herr Jesus Christus mit genau derselben Botschaft (Matthäus 4,17)."},{"author-name":"Bogolepow D.P.","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c96d263b8c22d9c467bdab_no-pic-theosis.png","category":"Christliche Autoren","century":19,"exegesis-text":"Die Evangelisten nehmen den Täufer als göttlich gesandten Propheten und Vorläufer des Messias wahr. Dies wird deutlich, indem sie betonen, dass in ihm die alttestamentlichen Weissagungen über den Wegbereiter des Herrn, den Engel Gottes, erfüllt werden. In allen Evangelien findet sich ein Zitat aus Jesaja 40,3; in Lukas wird es ausführlicher dargestellt (Jesaja 40:3-5). Markus, der in seinem Werk oft nur selten Vergleiche zwischen neutestamentlichen Ereignissen und alttestamentlichen Prophezeiungen zieht, zitiert hier stärker aus Maleachi 3,1, welches auch bei Matthäus (Matthäus 11,10) und Lukas (Lukas 7,27) so wiedergegeben wird, als sei es ein Zeugnis von Jesus Christus über den Täufer. Jesajas Weissagung bezieht sich primär auf die Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft, für die der Prophet einen Boten beschreibt, der ruft: In der Wüste sollen sie dem Herrn einen geraden Weg bereiten, indem sie das Tal auffüllen und die Berge und Hügel niederrichten. Diese Weissagung ist eine Botschaft nicht nur für den Herrn, sondern auch für sein Volk. Die Evangelisten und Johannes der Täufer selbst (Johannes 1,23) verstehen diese Weissagung in einem präformativen Sinne: Der Herr, der bei der Rückkehr aus der Gefangenschaft an der Spitze seines Volkes führt, ist der Messias, und der Bote ist Johannes. Die Wüste, in diesem geistlichen Kontext, steht für das Volk Israel, dessen Sünden die Hindernisse sind, die dem Kommen des Messias im Wege stehen. Daher fordert Johannes zur Buße auf.\\n\\nMaleachi, als letzter der alttestamentlichen Propheten, bringt Johannas Rolle als Wegbereiter des Messias prägnant zum Ausdruck, indem er ihn Engel des Herrn nennt. In den Evangelien wird der Zeitpunkt von Johannes’ Predigt nicht genau festgelegt. Während Markus gar keine Angabe macht, wird bei Matthäus erwähnt, dass es „in jenen Tagen“ war, während Lukas eine klare chronologische Angabe schafft, indem er den politischen und religiösen Zustand zu jener Zeit beschreibt (Lukas 3,1-2). Die Detailgenauigkeit dieser Darstellung betont die Wichtigkeit von Johannes’ Auftritt für die Evangeliumsverkündigung sowie den Zustand der Welt, in dem das erlösende Wirken Jesu stattfand. Zu dieser Zeit war Judäa zur römischen Provinz geworden. Der Evangelist definiert zunächst die Zeit im Jahr der Herrschaft von Kaiser Tiberius (im 15. Jahr) und führt dann die zivilen Herrscher in Palästina auf: Pilatus, den Prokurator in Judäa, sowie die Tetrarchen Herodes Antipas, Philippus und Lysanias. Schließlich nennt er die religiösen Führer, darunter die Hohepriester Hannas und Kaiphas. Johannes der Täufer predigte in der Wüste; während Markus nur „Wüste“ erwähnt, nennt Matthäus es spezifisch die jüdische Wüste. Diese Gegend erstreckt sich am Westen des Toten Meeres bis nach Jericho. Auch die Erwähnung des Jordans, wo Johannes taufte, unterstützt die Lage der Wüste. Lukas beschreibt ebenfalls den Ort, wo „die Stimme Gottes zu Johannes sprach“ (Lukas 3,2), und verwendet eine bildhafte Sprache, um das gesamte Wirken von Johannes zu umfassen.\\n\\nIn seiner Erscheinung, beschrieben von Matthäus (3,4) und Markus (1,6), ähnelt Johannes dem Tishbiter Elia (4. Könige 1,8), dessen Geist und Kraft er gemäß Maleachi (4,5) und der Ankündigung des Erzengels Gabriel (Lukas 1,17) vor dem Messias wirken sollte. Die zeitgenössischen Juden erwarteten aufgrund der Weissagung Maleachis die Erscheinung Elias, die sie als Auferstehung interpretierten (Johannes 1,21). Mit seinem Erscheinen deutete Johannes bereits diese Erwartungen an. Er lebte asketisch als Nazaräer (Lukas 1,15) und lebte von dem, was die raue Wüste ihm bot: Heuschrecken und wilder Honig. Nur Lukas berichtet über seine Einsamkeit in der Wüste nach dem Verlassen seines Elternhauses (Lukas 1,80) und stellt fest, dass Gott zu Johannes sprach (Lukas 3,2).\\n\\nDie Evangelisten Markus (1,4) und Lukas (3,3) fassen das Wirken von Johannes einheitlich, indem sie erwähnen, dass er taufte und die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden predigte. Matthäus bezieht sich direkt auf die Worte des Täufers (Matthäus 3,3): „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen.“ Dies zeigt, dass schon zu Beginn von Johannes’ Wirken ein klarer Bezug zum Reich des Messias bestand. Buße (μετανοία) stellt ein lebendiges Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit dar, begleitet von aufrichtiger Reue und dem festen Willen, das Leben zu ändern (2. Korinther 7,9.10). Johannes stellte den Menschen die Frucht der Buße als Weg zur Rettung vor dem kommenden Zorn dar (Matthäus 3,8; Lukas 3,8). Seine Bußpredigt war nicht nur eine innere Umkehraufforderung, sondern auch eine Einladung zur öffentlichen Bekennung der Sünden (Matthäus 3,6; Markus 1,5). Die Evangelisten beschreiben diese Bekennung als Teil der Buße zur Vergebung der Sünden, die zur Vorbereitung auf die endgültige Vergebung durch Christus führte, die erst nach der Erfüllung des Erlösungswerks kommen konnte.\\n\\nDie äußere Bezeugung der Buße war die Taufe, die Taufe zur Buße, die durch das Untertauchen in Wasser symbolisiert wurde. Diese wurde nicht von den alttestamentlichen Propheten praktiziert. Die Predigt des Johannes über die Umkehr war untrennbar mit der Taufe verbunden, da sie auch eine Verkündigung des nahenden Himmelreiches war. Seine Taufe diente daher nicht nur als Zeichen reueliger Herzen, sondern auch als Ausdruck des Glaubens an den kommenden Messias. Der Apostel Paulus erklärt: „Johannes taufte mit der Taufe der Buße und sprach zu den Menschen, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kam, nämlich an Christus Jesus“ (Apostelgeschichte 19,4). Dies deutet an, dass Johannes im Namen desjenigen taufte, der nach ihm kommen sollte, wobei er formulierte: „Ich taufe euch im Namen des Kommenen“ (vgl. 1. Korinther 10,2). Johannes selbst bezeugte jedoch, dass seine Taufe nicht die vollendete Taufe war, die zur Erlösung genügt; er taufte mit Wasser zur Buße, doch der, der kommen würde, würde mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen (Matthäus 3,11 u.ö.). Daher brachte die Taufe des Johannes nicht die Gnade des Heiligen Geistes, sondern war lediglich ein vorbereitender Ritus zur Buße, der die Menschen auf das Sakrament der Taufe vorbereitete."},{"author-name":"Bogoslovski M.I.","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c889e63432c6dd413681d2_Bogoslovski%20M.I..png","category":"Christliche Autoren","century":19,"exegesis-text":"Dem öffentlichen Dienst Jesu Christi und seiner Geburt gingen bedeutende und wundersame Ereignisse voraus: 1) das Wirken Johannes des Täufers, seine Predigt, die Taufe des Volkes und sein Zeugnis über Christus; 2) die Taufe Jesu durch Johannes, die Herabkunft des Heiligen Geistes auf ihn und das Zeugnis Gottes des Vaters über ihn; 3) das vierzig Tage dauernde Fasten und die Versuchung unseres Herrn durch den Widersacher. Diese Ereignisse sind nicht nur zeitlich, sondern auch ursächlich eng miteinander verbunden. Johannes wurde von Gott gesandt, um Israel die Ankunft einer neuen Ordnung der Dinge, das Eintreten des Reiches Gottes anzukündigen; durch seine Bußpredigt sollte er das Volk auf die Ankunft des erwarteten Messias vorbereiten. Kurz darauf tritt der von Gott verheißenen Retter, Jesus Christus, in Erscheinung. Um sich auf die große Aufgabe seines Dienstes vorzubereiten – die Errichtung des Himmelreichs auf Erden –, lässt er sich zunächst von Johannes taufen und wird dann von dem Teufel versucht. Die Berichte über diese vorbereitenden Ereignisse in den Evangelien von Matthäus und Lukas bilden einen gelungenen Übergang von der Kindheitsgeschichte Jesu zu seinem öffentlichen Dienst. Im Evangelium nach Markus hingegen beginnt die Erzählung direkt mit diesen Ereignissen. Markus lässt die Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu außen vor und beginnt sein Evangelium zu dem Zeitpunkt, an dem die öffentliche Verkündigung des kommenden Erlösers und die Gründung seines gnadenreichen neuen Reiches ihren Anfang nahm. Auch der Heilige Petrus verweist in seinem Gespräch mit Kornelius darauf (Apg 10,36 ff.). Daher ist es angemessen, die Geschichte des öffentlichen Wirkens unseres Herrn mit diesen vorbereitenden Ereignissen zu beginnen: dem Auftreten Johannes des Täufers, seiner Predigt, der Taufe des Volkes und seinem Zeugnis für Christus (Mt 3,1-12; Mk 1,1-8; Lk 3,1-18). Johannes der Täufer trat gemäß der Vorhersage des Engels (Lk 1,17), die von Sacharja (V. 76) wiederholt wurde, in Dienst und wirkte im Geist und in der Kraft des Elia. In ihm, dem letzten Propheten des Alten Testaments, bündeln sich all die Lichtstrahlen, die dem Aufgang der Sonne des Heils vorausgingen. Alles, was die Propheten des Alten Testaments über das Kommen des Erlösers in die Welt verkündet hatten, alle Ermahnungen, Warnungen und Strafen, die Gott durch sie an sein Volk gerichtet hatte, finden in seiner Botschaft eine Vereinigung, um die Herzen der Schlafenden zu erwecken und den Drang nach Erlösung zu entfachen, damit der Herr ein bereitetes Volk erhält (Lk 1,17). Johannes war nicht berufen, über diese Grenzen hinauszugehen; er blieb der Vorläufer des Messias. Als das Volk, von seiner Predigt zur Umkehr und der Anzeichen des Himmelreiches bewegt, auf ihn schaute und überlegte, ob er der Christus sei, verwies Johannes auf den, der nach ihm kommen würde, und erklärte, dass er nicht einmal würdig sei, dessen Sandalen zu tragen (Mt 3,11). Mit tiefster Freude äußerte er, dass es auf den, der nach ihm kommt, ankomme, berühmt zu werden, während er selbst kleiner werde (Joh 3,30). Trotz seiner Nähe zum Neuen Testament und dessen Berührung war Johannes in Geist und Charakter ganz ein Vertreter des Gesetzes und stellte lediglich den Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament dar, gleich einem Stein in einem Gebäude (Mt 11,9). Der deutliche Unterschied zwischen Christus und seinem Vorläufer macht den Unterschied zwischen den beiden Testamenten klar; Gesetz und Evangelium sind zwei verschiedene Sphären des Lebens, die nicht vermischt werden dürfen; nur der Glaube an Jesus Christus verbindet sie geheimnisvoll miteinander. Obwohl Johannes der letzte Baustein des alten Testamentes ist und dessen Charakter vollkommen verkörpert, ist er dennoch größer als alle, die von Frauen geboren wurden, obwohl der kleinste im Himmelreich größer ist als er (Mt 11,11). Die Aufgabe des Vorläufers beschränkte sich nicht allein auf die Verkündigung der Umkehr, sondern fand auch Ausdruck im Ritus der Taufe, der als Symbol der Umkehr diente. Diese Taufe führte Johannes nicht aus eigenem Antrieb ein, sondern durch die Eingebung des Heiligen Geistes, der ihn in allem leitet, auch in der Einführung dieses Ritus. Johannes selbst bezeugt, dass er gesandt wurde, um mit Wasser zu taufen (Joh 1,33). Die ersten drei Evangelisten - Matthäus, Markus und Lukas - berichten von Johannes’ Predigt und seiner Taufe des Volkes vor dem Erscheinen des Messias. Ihre Erzählungen stimmen in den wesentlichen Punkten überein, während die Unterschiede einige Einzelheiten betreffen, die einander ergänzen. Lukas gibt zu Beginn seiner Erzählung mit historischer Präzision den Zeitpunkt der Dienstaufnahme des Johannes an, was bei den anderen Evangelisten nicht erfolgt. Dabei gibt er auch den Ort seiner Predigt an. Allerdings schweigt Lukas über die Lebensweise des Johannes und seine Taufe des Volkes, während Matthäus und Markus darüber berichten. Zudem geben Matthäus und Lukas den Inhalt der Bußpredigt detaillierter wieder: Bei Matthäus richtet sich diese nur an die Pharisäer und Sadduzäer, in Lukas' Erzählung geht die Botschaft an das gesamte Volk, einschließlich Zöllner und Soldaten. Schließlich bezeugen alle drei Evangelisten jeweils Johannes' Aussage über Christus. Daraus wird deutlich, dass jeder Evangelist ein kompaktes Bild von Johannes’ Wirken als Vorläufer des Messias zeichnen wollte, welches dadurch in seiner Fülle und Klarheit erst durch den Vergleich ihrer Berichte sichtbar wird. Augustinus (de consens. Evang. lib. 11, c. 12) erklärt die Unterschiede in den Erzählungen damit, dass Johannes zu verschiedenen Zeitpunkten sprach – vor einigen Schülern und vor dem Volk – oder dass er die Worte der Evangelisten nicht wörtlich wiederholte. Wenn die Evangelisten auch nicht wortwörtlich wiedergeben, sondern nur die Absicht, die Johannes ausdrücken wollte, wiedergeben, so soll uns das auffordern, uns nicht nur mit dem Wortlaut der Schrift zu begnügen, sondern den Geist und Sinn einzufangen. Die synoptische Analyse des heiligen Textes sollte sowohl an Vollständigkeit als auch an Klarheit gewinnen – dies zum einen, während zum anderen die Einwände der Kritiker, die häufig auf vermeintlichen Widersprüchen in den Evangelien beruhen, von selbst verschwinden, ohne dass sie widerlegt werden müssen. Der allgemeine Inhalt der Erzählung kann in folgender Reihenfolge dargestellt werden: 1) Der Zeitpunkt der Amtsübernahme von Johannes dem Täufer (Lk 3,1-2. vgl. Mt. 3,1). 2) Der Ort des Auftretens von Johannes des Täufers mit seiner Predigt über Umkehr und das bevorstehende Himmelreich gemäß der prophetischen Vorhersage (Mt 3,1-3; Mk 1,1-4; Lk 3,3-6). 3) Die Lebensweise Johannes' und seine Taufe des Volkes (Mt 3,4-6; Mk 1,5-6). 4) Seine Lehren an die Pharisäer und Sadduzäer sowie an das ganze Volk (Mt 3,7-10; Lk 3,7-14). 5) Das Zeugnis des Johannes über Christus (Mt 3,11-12; Mk 1,7-8; Lk 3,15-18). Fahren wir mit der exegetischen Analyse nach dem genannten Schema fort: 1) Die Zeit, als Johannes der Täufer sein Amt antrat (Mt 3,1; Lk 3,1-2). In diesen Tagen trat Johannes der Täufer auf. Im fünften Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus über Judäa, Herodes über Galiläa und Philippus, sein Bruder, über Ituräa und das Land Trachonitis herrschte, und Lysanias, der Tetrarch über Abilene, mit den Hohenpriestern Hannas und Kaiphas, wurde das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste gesprochen. In der Erzählung des Evangelisten Matthäus wird der Zeitpunkt des Amtsantritts von Johannes dem Täufer nur vage angegeben. Der Ausdruck „In diesen Tagen kam Johannes ...“ dient weniger als Zeitangabe, sondern wird verwendet, um den Zusammenhang mit der vorherigen Erzählung herzustellen. Nach Maldonats Auslegung des Evangeliums Lukas versteht man dies im Kontext so: Während unser Herr sich noch in Nazareth befand, trat Johannes in den Dienst. Dieser Mangel an Genauigkeit wird jedoch im dritten Evangelium reichlich ausgeglichen. Um den Zeitpunkt von Johannes’ Dienstbeginn präzise zu bestimmen, nennt Lukas das Jahr der Herrschaft des römischen Kaisers Tiberius und zählt gleichzeitig alle weltlichen und geistlichen Herrscher des Heiligen Landes auf. Für die Geschichte im Allgemeinen und die evangelische Geschichte im Besonderen ist es von Bedeutung, dass der Evangelist betont, dass Johannes sein Amt im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Tiberius aufnahm, da man durch dieses Datum den Beginn der christlichen Ära genauer festlegen kann. Es bleibt nur die Frage, von wann man die Herrschaft des Tiberius zählen sollte. Aus der Geschichtsschreibung ist bekannt, dass Augustus zwei Jahre vor seinem Tod Tiberius zum Mitkaiser erklärte; dieser war der Stiefsohn des Kaisers Augustus und wurde von ihm zum Nachfolger bestimmt. Zählt man von diesem Zeitpunkt, dem fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Tiberius, müsste das auf Ende des Jahres 779 oder Anfang des Jahres 780 fallen. Zählt man von Augustus’ Tod, dem 19. August 767, ergibt sich das Jahr 782. Diese letzte Berechnung kann jedoch kaum angenommen werden, da man auch Jesus Christus und Johannes der Täufer in diesem Fall etwa 83 Jahre alt hätte gelten müssen, was nach dem angenommenen Geburtsjahr 749 kaum passt. Dieses Datum kann also lediglich als ungefähr richtig betrachtet werden. Es gibt jedoch andere Gründe für eine genauere Festlegung des Geburtsjahres Christi - die sogenannten Osterdaten, auf die später eingegangen wird. In der Zwischenzeit wurde Jesus Christus nach dem Evangelisten Lukas (3,23) getauft und begann seinen Dienst im Alter von etwa dreißig Jahren, etwas mehr oder weniger. Auch die neuesten Wissenschaftler, wie Wieseler, Zumpt, Godet, Schanz, Hoffmann, Farrar und andere, zählten die Regierungszeit des Tiberius ab dem Zeitpunkt seiner Erklärung zum Mitkaiser von Augustus, und diese Zählung ist als präziser zu betrachten. Nach dieser Berechnung trat Johannes in der zweiten Hälfte des Jahres 779, genau im Herbst, in den Dienst. Diese Aussagen des Evangelisten sind nicht von besonderer Bedeutung für die Chronologie des Evangeliums, haben jedoch in anderer Hinsicht Relevanz. a) Politisch hatte Palästina zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Unabhängigkeit, die es unter Herodes dem Großen genossen hatte; es war in vier Teile geteilt, gemäß der römischen Praxis, eroberte Länder in sogenannte Tetrarchien zu unterteilen. Diese Aufteilung wurde von Herodes selbst eingeleitet, indem er sein Reich unter seinen drei Söhnen verteilte. Herodes hatte zehn Frauen und von den ersten sechs neun Söhne; der älteste war Antipater, den er kurz vor seinem Tod wegen Hochverrats hinrichten ließ; die nächsten beiden, Alexander und Aristobulus, wurden drei Jahre vor Christus von Herodes hingerichtet. Archelaus erbte Judäa, Idumäa und Samaria, behielt aber nicht lange den Königstitel, da er von den Römern zum Ethnarchen ernannt wurde. Seitdem wurden in Judäa immer wieder römische Statthalter eingesetzt, die Prokuratoren oder Epitropes genannt wurden. Diese hielten sich gewöhnlich in Cäsarea am Mittelmeer auf und kamen nur zu den Festtagen nach Jerusalem, um für Ordnung zu sorgen. Pilatus, den Lukas erwähnt, war der sechste Prokurator (vgl. Jos. Flav. Ant. XVIII, 2. 2). Man nimmt an, dass „Pilatus“ kein Name, sondern ein Beiname ist, den er aufgrund seines Wurfes mit einem Speer erhielt. Der Evangelist schreibt ihm den Titel Ægemon zu, der dem kaiserlichen Statthalter in Syrien zustand. Die Ernennung Pilatus als Prokurator von Judäa (im Jahr 779) fiel mit dem Dienstantritt von Johannes zusammen. Besonders bemerkenswert ist, dass Pilatus Christus zur Kreuzigung verurteilte. Philon, ein Zeitgenosse von Pilatus, beschreibt ihn als gewalttätig und grausam. „Er war böse und grimmig“, sagt Philon, „und wollte nichts tun, was seinen Untertanen gefiel“. Für seine Grausamkeit wurde er schließlich (im Jahr 789) ebenfalls wie Archelaus nach Gallien verbannt, wo er Selbstmord beging. Damit stand Judäa - sowie Samaria und Idumäa - nun unter direkter römischer Herrschaft, leidend unter dieser Fremdherrschaft. Von den anderen drei Regionen befanden sich zwei weiterhin in den Händen der Familie Herodes. So wurde Galiläa, auch Derea, von Herodes Antipas, dem sechsten Sohn Herodes' des Großen mit dem Titel Tetrarch, regiert. Jesu Christus nannte ihn unter anderem „Fuchs“, sowohl wegen seiner List als auch wegen seiner schlechten Taten. Es ist bekannt, dass er sich mit der Frau seines Bruders, Herodias, verheiratete, und dass er auf ihren Wunsch Johannes tötete, als dieser ihn dafür zurechtwies. Herodes Antipas bemühte sich, den Römern zu gefallen und errichtete zu Ehren Tiberius’ die Stadt Tiberias in Galiläa. Während seiner Regierung begann und endete Christus sein öffentliches Wirken. Im Jahr 792 wurde Herodes von Caligula entmachtet. Sein Bruder Philippus, der siebte Sohn von Herodes dem Großen, regierte die Tetrarchie von Ituräa, Trachonitis und Vatanea. Über Ituräa, Teil der Tetrarchie von Philippus, erwähnt Josephus Flavius nichts. Doch dies entkräftet nicht die Richtigkeit von Lukas’ Zeugnis, obwohl Josephus keine detaillierte Aufzählung aller Orte gibt. In den Altertümern wird gesagt, dass Philippus Vatinæa mit Trachonitis und Avranitida erhielt. Es wird zwischen Jethurea, einem der Nachkommen Ismaels, und dem Land der Trachoniter unterschieden, das auch in Lukas erwähnt wird. Philippus war von besserem Charakter als seine Brüder, jedoch ebenso den Römern unterworfen. Auch er benannte eine Stadt Cäsarea und unternahm von dort seine letzte Reise nach Jerusalem; eine weitere Stadt, Bethsaida, wurde zu Ehren von Augustus’ Tochter Julia gegründet. Er regierte bis zu seinem Tod (von 750-787). Die vierte Tetrarchie fiel an Lysanias, die Avilineia genannt wurde, nach der Stadt Avila. Diese Region grenzte an Galiläa, dem Hauptort des Wirkens Christi. In der Tat haben Kritiker des Lukas (Strauss, Keim) behauptet, seine Erwähnung von Lysanias sei ein Beweis für die Ungenauigkeit der Evangelien. Die Tatsache ist jedoch, dass Lysanias, der Sohn und Nachfolger von Ptolemaios, der von Antonius auf Betreiben von Kleopatra hingerichtet wurde, etwa sechzig Jahre vor der Zeit des Evangelisten regierte. Kritiker unterstellen Lukas, hier in einen Anachronismus zu verfallen. Doch diese Anschuldigung wird durch neuere Beweise widerlegt. Josephus Flavius erwähnt, dass Agrippa nach Tiberius’ Tod die Tetrarchie des Philippus und die des Lysanias erhielt, was eindeutig den Tetrarchen Lysanias von Lukas betrifft, einem Zeitgenossen Philipps. Zudem belegen neu entdeckte Münzen und Inschriften die historische Richtigkeit von Lukas’ Zeugnis über Lysanias. Diese Angaben weisen darauf hin, dass nicht Lukas im Irrtum war, sondern die Kritiker unzureichend über die Geschichte Palästinas zur Zeit Christi informiert sind. b) Der kirchliche Zustand im Heiligen Land war noch bedenklicher als der politische. Nach dem Gesetz mussten die Juden stets einen Hohepriester haben (Num 35,25), doch dies war nicht mehr der Fall. Nach der römischen Herrschaft wechselten die Prokuratoren häufig die Hohepriester und setzten neue Priester nach eigenem Belieben ein. Josephus berichtet, dass der von Lukas genannte Hohepriester Hannas von Valerius Gratus abgesetzt wurde; an seiner Stelle traten verschiedene Priester nacheinander an, die zunehmend die Legitimität ihrer Ämter verloren. Hannas war ein besonders unmoralischer Hohepriester. Zur Zeit Lukanias’ gab es daher niemanden von Bedeutung in der religiösen Führung. Lukas nennt Hannas und Kaiphas, um darzustellen, dass die alte Theokratie völlig zerfallen war, genau als jener erscheinen sollte, der das Reich Gottes neu aufbauen würde. Es war zu dieser Zeit, dass Gott zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste sprach, um ihm den Auftrag zu geben, den Weg des Herrn vorzubereiten."},{"author-name":"Dreifaltigkeitsblätter des Abtes Panteleimon","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c96d263b8c22d9c467bdab_no-pic-theosis.png","category":"Christliche Autoren","century":19,"exegesis-text":"Wie der Morgenstern vor dem Sonnenaufgang erschien, trat der Vorläufer hervor und verkündete unerschrocken das Kommen des Lichtes der Gerechtigkeit, Jesus Christus. In jener Zeit, als der Herr noch in Nazareth lebte, kam Johannes, der Täufer, auf göttlichen Befehl aus seiner Einsamkeit und predigte in der judäischen Wüste, die westlich des Todesmeeres liegt. Vom Heiligen Geist geleitet, durchquerte er das gesamte Jordantal von diesem Gewässer bis zum See Genezareth. Anstatt in die Städte und Dörfer Judäas zu ziehen, wie es die Propheten des Alten Testaments taten, verkündete der Vorläufer Christi in der Wüste: Umgeben von den majestätischen Landschaften der Natur, in der stillen Erhabenheit der Felsen und Berge Judas oder an den blühenden Ufern des tosenden Jordans versammelten sich die Menschen aus allen Richtungen, um das Wort des kommenden Messias zu empfangen. Hier gab es weniger unnötige Neugier infolge der Menschenmengen; die hochmütigen Schriftgelehrten und Pharisäer konnten ihn nicht aufhalten. In der Freiheit seiner vertrauten Wüste, die durch ihre Unberührtheit und Abgeschiedenheit vom Lärm urbanen Lebens zur Reflexion über die Sünden und zur Umkehr einlud, rief er laut: Tut Buße!"},{"author-name":"Michail (Lusin)","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c89550c567e172d15b3055_Michail%20(Lusin).png","category":"Christliche Autoren","century":19,"exegesis-text":"In jenen Tagen: nicht zu der Zeit, als der Herr sich in Nazareth aufhielt, denn Johannes der Täufer war nur ein halbes Jahr älter als der Heiland, und dem Zeugnis des Heiligen Lukas zufolge trat Johannes mit einer Botschaft auf, als auch Christus, der zu ihm kam, um sich taufen zu lassen, etwa 30 Jahre alt war (Lk 3,23). \\"Diese Ausdrucksweise wird in der Schrift häufig gebraucht: in jenen Tagen, wobei nicht nur Ereignisse direkt nacheinander, sondern auch solche, die nach vielen Jahren kamen, gemeint sind\\" (Chrysostomus). Allgemein handelt es sich hierbei um eine Formulierung in den Erzählungen, die keine strikte chronologische Abfolge aufweist (vgl. Lk 2,1). Wenn an dieser Stelle die Verbindung zwischen Vorangegangenem und Nachfolgendem beschrieben wird, könnte diese Verbindung folgendermaßen formuliert werden: Während Jesus Christus noch in Nazareth wohnte, war Johannes tätig usw. (vgl. Lk 2,1). Johannes der Täufer: der Sohn des gerechten Zacharias und der Elisabeth (Lk 1,5 usw.), der den Namen des Täufers erhielt, weil er als Vorläufer Christi zur Umkehr aufrief und diejenigen, die zu ihm kamen, taufte. Er tauchte sie in Wasser und verwendete dies als Symbol für die Reinigung der Seele (vgl. Anmerkung zu Matthäus 3,11). Predigen in der Wüste: predigen bedeutet, das Wort Gottes zu verkünden, zu lehren und öffentlich zu erklären. Die Botschaften des Johannes, die in den Evangelien festgehalten sind, bestehen hauptsächlich aus kurzen Aussagen, deren Anzahl sehr begrenzt ist. Die Wüste von Judäa war ein Gebiet einige Werst westlich des Toten Meeres, geprägt von Bergen und mehreren kleinen Flüssen, die die gesamte Region von Bathseba durchzogen. Das Wort Wüste bezeichnet dabei kein vollkommen unbewohntes Gebiet, sondern eine Region, die aufgrund ihrer relativen Wildnis nur spärlich bewohnt ist, bergig, trocken und von Felsen sowie Klippen durchzogen, bewaldet und wenig bebaut. In der Wüste der Juden gab es auch kleine Siedlungen (Num. 15:61, 62, 1 Sam. 25:1, 2). Wenige Versts südlich von Bethlehem, in einem wüstenartigen Gebiet, sind noch eine Höhle, in der Johannes lebte, und eine Quelle, aus der er trank, verzeichnet."},{"author-name":"Gladkow B.I.","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c88bf0ceef8c96e09a6521_Gladkow%20B.I..png","category":"Christliche Autoren","century":19,"exegesis-text":"Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Tiberius, das heißt im Jahr 779 nach der Gründung Roms, trat Johannes, der Sohn von Zacharias und Elisabeth, in Erscheinung. Er war nun dreißig Jahre alt und hatte das erforderliche Alter erreicht, um zu lehren. Durch eine besondere Eingebung von oben verließ er die Wüste und wanderte durch das gesamte umliegende Land des Jordans, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen."},{"author-name":"Nekrasow A.A. Prof.","author-image":"https://cdn.prod.website-files.com/6864003fdf3714da6ff0b33a/68c96d263b8c22d9c467bdab_no-pic-theosis.png","category":"Christliche Autoren","century":19,"exegesis-text":"In jener Zeit trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste Judäas. Es besteht die Möglichkeit, diesen Vers unverändert zu belassen. Wenn wir jedoch eine Anmerkung machen wollen, dann lediglich, um das Urteil von Fachleuten der griechischen Sprache zu ergründen, ob zwei griechische Begriffe in der vorgestellten Bedeutung verwendet werden können: ἡμέρα und παραγίγνομαι (ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς). Das Wort ἡμέρα hatte neben seiner üblichen Bedeutung als Tag auch eine allgemeinere Dimension, die Alter und Zeit umschloss: πρώτη ἡμέρα ἡμέρα = jugendliches Alter, τελευταία ἡμέρα = reifes Alter, παλαιὰ ἡμέρα = hohes Alter; ἡμέρα κλίνει τε κἀνάγει πάλιν ἅπαντα τἀνθρώπεια = die Zeit neigt sich und hebt letztlich alles Menschliche wieder empor. Bereits zuvor haben wir das Verb παραγίνομαι oder παραγγίγνομαι erwähnt. Dieses Verb bedeutet, von irgendwoher zu kommen, sich aufzuhalten oder im Vorübergehen zu erscheinen. Der gesamte Vers könnte so formuliert werden: \\"Zu dieser Zeit erscheint Johannes der Täufer mit einer Botschaft in der Wüste Judäas.\\" Der Ausdruck „in jenen Tagen“ deutet darauf hin, dass Johannes der Täufer kurz nach der Geburt Christi mit seiner Verkündigung einsetzte, obwohl er selbst nur wenige Monate älter war als der Heiland, der erst im Alter von dreißig Jahren getauft wurde."}]}
Unterstütze dieses Projekt und erhalte vollen Zugang für ca. 4€/Monat*
Kommentartexte können derzeit am PC nicht gescrollt oder geklickt werden. Bitte nutze dein Handy. Wir arbeiten an einer Lösung.